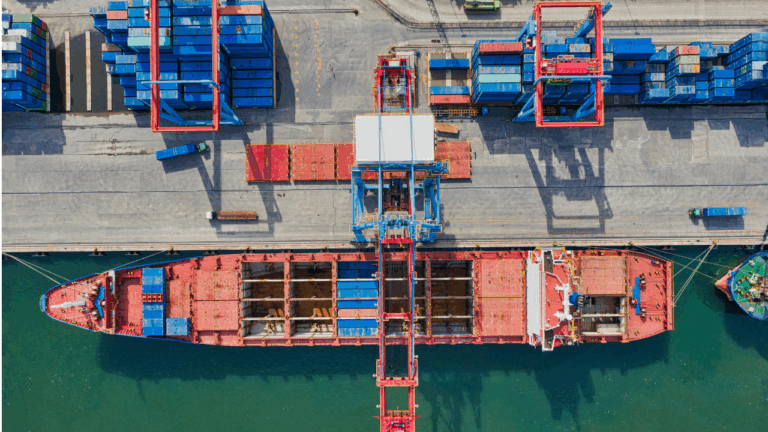Cash in GuV & Bilanz – dank Härtegrad-Logik
Wo steckt das gebundene Geld? Supply-Chain-Experte Ingo Glawe erklärt im Interview, wie Unternehmen Cash aus Beständen lösen – dank Härtegrad-Logik, die nur bestätigte Ergebnisse gelten lässt. Grundsätzlich lassen sich je nach Branche und Unternehmen 5 bis 20 Prozent des Bestands reduzieren und entsprechen Cash freisetzen.
Was tut den Kunden in Sachen Lieferketten derzeit am meisten weh?
Die Herausforderung besteht darin, Reaktionsfähigkeit durch intelligente Prozesse zu sichern – statt durch hohe Lagerbestände. Unternehmen brauchen kurze Durchlaufzeiten, um Nachfrage schnell bedienen zu können; zugleich bindet zu viel Bestand Cash, das man für neue Geschäfte, Investitionen und Liquidität benötigt. Viele Unternehmen wollen Cash aus dem operativen Geschäft heben, daher zielen wir auf Kürzung der Durchlaufzeiten und gezielte Bestandsreduktion, ohne die Lieferfähigkeit zu gefährden. Unsere Kunden sind oft darüber erstaunt wie viel Liquidität sich in der Lieferkette versteckt.
Gibt es zum Projektstart eine Standortbestimmung bzw. einen Supply-Chain-Health-Check? Wie läuft das ab?
Ja. Wir starten mit einem gezielten Self- bzw. Health-Check, der aus drei klaren Phasen besteht. In Phase 1 erfassen und analysieren wir alle verfügbaren Daten. Das dauert in der Regel rund zwei Wochen, weil Datenqualität und Verfügbarkeit oft begrenzt sind. In vielen Terminen klären wir zunächst, welche Daten es überhaupt gibt, wo sie liegen und wie wir sie sinnvoll aufbereiten können.
In Phase 2 folgt die Validierung vor Ort: Wir prüfen Prozesse und Organisation im täglichen Ablauf und führen strukturierte Interviews mit den Mitarbeitenden der beteiligten Bereiche. Umfang und Dauer hängen von Komplexität und Unternehmensgröße ab – typischerweise rechnen wir hier mit ein bis zwei Wochen.
Auf dieser Basis erstellen wir in Phase 3 den Business Case und einen konkreten Fahrplan: Wir priorisieren die Maßnahmen (z. B. mittels ABC-Logik), stellen Investitionen dem zu erwartenden Potenzial inklusive Payback gegenüber und formulieren eine Roadmap mit klaren Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Meilensteinen und Zielwerten für die Umsetzung.
In welche Phasen ist ein solches Projekt unterteilt? Welche Maßnahmen erfolgen wann, mit welchen Zielen, und wie lange dauern die Schritte?
Wir arbeiten in vier aufeinander aufbauenden Phasen. Zunächst die Analyse (3 bis 4 Wochen): Hier schaffen wir Transparenz, indem wir Daten, Prozesse und Kennzahlen so aufbereiten, dass eine belastbare Ausgangsbasis entsteht.
Daran schließt sich die Konzeptphase (2 bis 3 Wochen) an, in der wir die konkreten Lösungen definieren – von der passenden Bestands- und Planungslogik über erforderliche Parameteranpassungen im ERP bis hin zu Prozess- und Ablaufänderungen.
Im dritten Schritt erstellen wir den Umsetzungsplan (1 bis 2 Wochen): Ein Project Management Office (PMO) setzt den Rahmen, Verantwortlichkeiten werden festgelegt, die richtige Reihenfolge der Maßnahmen bestimmt und messbare Meilensteine hinterlegt. So wird sichergestellt, dass die geplanten Maßnahmen termingerecht umgesetzt und die Effekte im Controlling bestätigt werden. Anschließend begleiten wir den Kunden in Phase 5 bei der Umsetzung des Fahrplans (mehrere Wochen bis Monate), um die vereinbarten Hebel konsequent zu realisieren.
Die Ergebnisse zeigen sich in der Gewinn- und Verlustrechnung?
Richtig, dazu nutzen wir die Härtegrad-Logik: Ein Ergebnis gilt erst dann als erzielt, wenn es vom Controlling bestätigt wurde und sich in GuV bzw. Bilanz niederschlägt. So stellen wir sicher, dass nicht nur „Parameter umgestellt“ werden, sondern dass nachweislich wirtschaftliche Effekte realisiert sind.
Welche kurzfristigen Maßnahmen (Quick Wins) gibt es?
Fünf Schritte bringen schnell Wirkung.
Erstens passen wir die Bestände physisch an, indem wir Ziel- und Maximalbestände je Bereich festlegen. Dazu zählt auch die Lagerzonen räumlich und logisch so umzustrukturieren, sodass die richtigen Artikel am richtigen Platz liegen – mit kurzen Wegen, klaren Mengenlimits und passender Wiederauffüll-Logik. So verhindern wir aktiv Lagerüberfüllung. Unser Ziel: Lagerbestände optimieren, Durchlaufzeiten verkürzen, Kommissionierfehler und Suchzeiten senken.
Zweitens frischen wir die ERP-Bestandsparameter auf (Mindest- und Sicherheitsbestände, Losgrößen, Wiederbeschaffungszeiten) und nutzen dafür einfache digitale Auswertungen, die den Planern konkrete Anpassungsvorschläge liefern, statt nur auf Bauchgefühl zu setzen.
Drittens verbessern wir die Bedarfsprognosen, damit genau die Produkte beschafft und gefertigt werden, die tatsächlich benötigt werden. Das erhöht Servicegrad und Kundenzufriedenheit.
Viertens prüfen wir die Einführung von Konsignationslagern mit strategischen Lieferanten: Die Ware bleibt bis zum Verbrauch im Eigentum des Lieferanten, sichert so die Verfügbarkeit, senkt die Kapitalbindung sofort und erhöht die Dispositionsflexibilität. Besonders geeignet ist dieses Modell für C-Teile und häufig benötigte Komponenten – die Lieferfähigkeit bleibt dabei unverändert hoch.
Und fünftens bauen wir Obsoletes – auch in Abstimmung mit dem CFO – konsequent ab: durch Sonderaktionen und Abverkauf; wenn wirtschaftlich sinnvoll, auch durch Verschrottung – das schafft sofort Liquidität.
Diese Maßnahmen sind schnell aufsetzbar, transparent in der Umsetzung und liefern früh messbare Effekte.
Welche langfristigen Maßnahmen wirken nachhaltig?
Wir treffen strukturprägende Entscheidungen wie Make-to-Order versus Make-to-Stock konsequent je Produkt und Markt – und setzen sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette um. Die Wahl ist stets kontext- und kriterienspezifisch (u. a. Produktcharakter, Markt, Vertriebsstrategie, geforderte Verfügbarkeit) und wird gemeinsam mit Kunden abgestimmt.
Unser Ziel ist, Bestände systematisch zu senken und gleichzeitig die Lieferfähigkeit zu sichern.
Welche Tools/Technologien/Ressourcen setzt ihr ein?
Das Rückgrat bildet ein sauber parametrisiertes ERP (u. a. Wiederbeschaffungszeiten, Min/Max, Losgrößen). Ergänzend setzen wir Analytics und digitale Tools ein, um Trends früh zu erkennen und Parameter-Reviews zu beschleunigen – bis hin zu konkreten Vorschlagslisten für die Planung. Das Grundprinzip lautet: Prozesslogik zuerst, dann IT – die Technologie folgt dem Zielbild, nicht umgekehrt. Flankierend sorgen das PMO und erfahrene Berater für Tempo und Verbindlichkeit: vollzeitig aufgesetzt, klar verantwortlich und fokussiert auf die Umsetzung.
Wie holt ihr die Mitarbeitenden ab? Welche internen Stakeholder sind eingebunden?
Wir arbeiten mit einer Change-Story je Persona (Führung, Planung/SCM, Produktion/Logistik, Entwicklung, Vertrieb, Finanzen/Controlling, IT): „Wo stehen wir – was wollen wir erreichen – was bringt es mir?“
Die Betroffenen werden frühzeitig eingebunden und gestalten mit; so entstehen praxistaugliche Lösungen mit hoher Akzeptanz. Projekte laufen überwiegend vor Ort und werden durch regelmäßige Workshops getragen; Lenkungskreis und klare Verantwortlichkeiten sichern Geschwindigkeit und Verankerung.
Wie messt ihr den Erfolg?
Vor Start legen wir quantitative Zielwerte fest (z. B. x % Bestandsreduktion, €-Kosteneffekt, Ziel-Servicegrad). Diese KPIs werden während und nach dem Projekt verfolgt. Entscheidend ist: Es gelten nur harte, vom Controlling bestätigte Effekte – also solche, die sich in der GuV bzw. Bilanz niederschlagen. So stellen wir sicher, dass nicht nur „Parameter umgestellt“, sondern tatsächlich wirtschaftliche Resultate erzielt werden.
Wie stellt ihr die Nachhaltigkeit des Projekterfolgs sicher?
Wir bleiben nach den Umsetzungswellen eng dran: Es gibt regelmäßige Coachings und Quick-Checks – zunächst wöchentlich, später in größeren Abständen (monatlich bzw. quartalsweise, je nach Reifegrad).
Wir vergleichen den Status laufend mit dem ursprünglichen Plan, justieren Maßnahmen nach und sichern die Umsetzung über klare Verantwortlichkeiten. Zudem binden wir alle Effekte fest an die bestehende Kennzahlenwelt (KPI-/Finanz-Reporting), sodass Fortschritte sichtbar bleiben, Abweichungen früh erkannt werden und die Verbesserungen dauerhaft im Tagesgeschäft wirken.
Welche Risiken bzw. Abhängigkeiten gibt es?
Das größte Risiko ist die fehlende Unterstützung durch das Top-Management. Wenn die mittlere Führungsebene will, aber das C-Level keinen klaren Veränderungswillen hat, scheitern Projekte. Wir minimieren das, indem wir früh einen starken Unterstützer in der Geschäftsführung benennen, den Lenkungskreis aktivieren und Vorstände eng im Dialog halten.
Eine weitere Herausforderung ist die zu Beginn oft eingeschränkte Datenqualität und -verfügbarkeit – deshalb veranschlagen wir für Phase 1 in der Regel rund zwei Wochen für Datensammlung, -bereinigung und Abstimmungen.
Daher stellen wir Analyse und Konzept bewusst voran und justieren die IT erst im Anschluss gezielt. Übergeordnet gilt unsere eben erwähnte Härtegrad-Logik: Effekte zählen erst mit Controlling-Bestätigung – damit sind sie realisiert und revisionssicher.

Kontakt:
KLOEPFEL by EPSA
Damir Berberovic
Tel.: 0211 941 984 33 | Mail: rendite@kloepfel-consulting.com